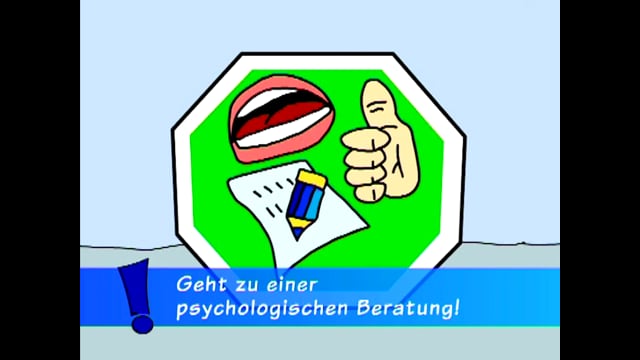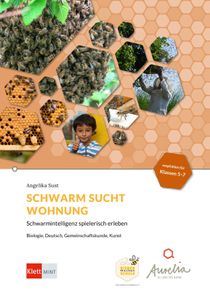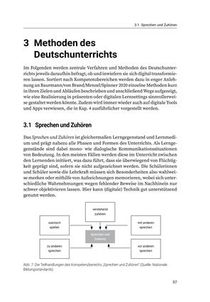Unterrichtsmaterialien Deutsch
4423 MaterialienIn über 4423 Dokumenten und Arbeitsblättern für das Fach Deutsch findest du schnell die passenden Inhalte für deine nächste Stunde. Jetzt kostenlos testen und mehr Materialien nach der Anmeldung entdecken!
Testen kostet nichts
Probiere meinUnterricht 14 Tage lang aus. Kündigst du während deiner Probezeit, entstehen für dich keine Kosten. 🚀
Verwandte Themen
Probezeit, entstehen für dich keine Kosten. 🚀
Arbeitsblätter & Übungen für den Deutschunterricht aller Schulformen
LehrerInnen und ReferendarInnen finden auf meinUnterricht.de die Lehrseiten und Arbeitsblätter, die sie für ihren Deutschunterricht benötigen. Die zahlreichen Übungen, Tests und Unterrichtseinheiten bei meinUnterricht.de stammen von den renommierten Fachverlagen Raabe, AOL Verlag, Auer, Friedrich und Persen/Bergedorfer und decken viele Lehrinhalte des Fachs Deutsch ab. Egal welches Thema, ob deutsche Rechtschreibung für Grundschüler oder Übersetzungen und Dialekte für Schüler ohne Deutsch als Muttersprache, meinUnterricht.de bietet zahlreiche Unterrichtsmaterialen für viele Einsatzszenarien.
Auf Verlagsmaterial zugreifen und deine Lieblings-Dateien online verwalten
Du kannst auf meinUnterricht.de eigene Kollektionen für dein Deutsch-Material anlegen und es in diesen sortieren und organisieren. So geht dir dein bestes Schulmaterial für zukünftige Deutsch-stunden nicht verloren und du bist an einem Platz, nämlich auf meinUnterricht.de, besser ausgestattet als je zuvor. Lege dir unbegrenzt Kollektionen an und gestalten diese genau so, wie du es brauchst. Ob du Arbeitsblätter für eine einzelne Deutschstunde, für eine ganze Unterrichtsreihe oder eine Projektwoche zu einem bestimmten Thema sammeln willst – das entscheidest du ganz allein.
Immer und überall Zugriff auf deine Vorbereitung
Auf meinUnterricht.de kannst du von jedem internetfähigen Endgerät zugreifen, egal wo du dich befindest. Damit hast du die Vorbereitung für deine nächste Deutschstunde ständig griffbereit zur Verfügung.
Registriere dich jetzt auf meinUnterricht.de und profitiere von den vielen Arbeitsblättern, Übungen und Prüfungen für das Fach Deutsch.